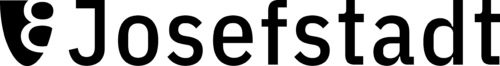ISLAJA aka. MERJA KOKKONEN (FIN)

Islaja, das künstlerische Alter Ego von Merja Kokkonen, ist eine finnische Komponistin, Performerin und bildende Künstlerin, die seit den frühen 2000er Jahren für ihre suggestiven Vocals und traumwandlerischen Klanglandschaften Anerkennung findet. Aus der experimentellen und psychedelischen Folk-Szene Finnlands hervorgegangen, bewegt sie sich in einem fortwährenden Prozess der Transformation, indem sie erdige Mystik mit „verzerrten und randständigen“ elektronischen Klangtexturen zu einer eigenwilligen, transgressiven Ästhetik verschmilzt.
Islaja’s music is a dream, abstract and enchanted but grounded in
the earthiness of a Finnish forest floor.
Kim Gordon
Oft mit Björk oder Syd Barrett verglichen und marmoriert mit dem vokalen Noir einer Nico, zeichnet sich Islajas Werk durch einen digitalen DIY-Ansatz der Early-Millennials sowie eine ausgeprägte künstlerische Vision aus, die konsequent auf die Überschreitung von Genregrenzen abzielt. Nach über einem Jahrzehnt in Berlin, wo sie als aktive Kollaborateurin des ausschließlich weiblichen Monika Werkstatt-Kollektivs (Gudrun Gut) wirkte und internationale Veröffentlichungen auf Labels wie Ecstatic Peace!, Fonal oder Not Not Fun realisierte, kehrte sie 2024 nach Helsinki zurück, um ihre Verwurzelung in der finnischen Kunstszene wieder verstärkt aufzugreifen. Merjas unverwechselbare Verbindung nordischer Mythologie mit der kreativen Hybridisierung des digitalen Zeitalters zeichnet ihren internationalen Erfolg aus.
Ihre jüngste Veröffentlichung, Angel Tape (Other Power, 2023), nimmt Bezug auf eine Kassettenaufnahme aus der Mitte der 1980er Jahre, die in religiösen Gemeinschaften zirkulierte und angeblich den Gesang von Engeln festhielt – ein klangliches Relikt, das Islaja bereits in ihrer Kindheit hörte. Im Nachhall der sich mit jeder Kopiergeneration überlagernden Schicht akustischer Artefakte erschließt sie nun ihren eigenen klanglichen Resonanzraum in der Nichtlokalität der magnetischen Einschreibungen dieses Techno-spirituellen Phänomens.
LUCY DUNCOMBE (UK) AND FERONIA WENNBORG (NO)

Lucy Duncombe, Glasgow, ist Musikerin und Künstlerin. Sie arbeitete experimentell mit der eigenen Stimme. Aus einem glitzernden Strom vokaler Arabesken webt sie Klangtexturen, die gleichermaßen als reine Popform wie auch als abstraktes, digital verfremdetes Artefakt nachhallen. Synthetische Klangströme, durchsetzt von Glitch und Doo-Wop, sprudeln hier aus dem künstlerischen Prozess. Ihr Sound lässt sich am besten als wirbelnde Neo-Avantgarde beschreiben, die musikalische Partikel einer sedimentierten Post-Post-Moderne zu wuchtigen Klangeindrücken aufwühlt.
Die norwegische interdisziplinäre Künstlerin und Musikerin Feronia Wennborg bewegt sich mit ihrer Arbeit fließend zwischen Performance, Installation, Klang und digitalen Medien. Verwurzelt in Aufnahmepraxis und digitaler Verarbeitung fängt sie Spuren von Intimität und Freundschaft ein und verwebt sie zu ozeanischen Klanglandschaften, die die Grenzen zwischen menschlicher Präsenz und technologischer Vermittlung verschwimmen lassen. Mit dem Pulsieren fragmentierter Vokalechos und texturierten digitalen Artefakten eröffnet sie Räume, in denen sich das soziale und imaginative Potenzial des Zuhörens entfalten kann.
assembling air
Das jüngste Projekt des Duos, assembling air, entspringt ihrer fluiden, neo-experimentellen Praxis, in der Stimme und Klang als lebendige, sich entwickelnde Entitäten neu gedacht werden. Seit den frühen 2020er Jahren arbeiten Lucy und Feronia zusammen und haben dabei eine eigentümlich intime Beziehung zu verschiedenen generierten Verfremdungswerkzeugen für Stimme entwickelt, deren durch KI vom Leben entfremdenden Eigenschaften sie gemeinsam ausloten und bewohnen. Mit ihrem gemeinsamen Erfahrungsschatz mit Stimme-basierter Technologie haben die Künstlerinnen nun eine Sprachklon-Software (Descript) mit ihren eigenen Aufnahmen trainiert und dieses „entfremdete Andere“ zum Instrument gemacht, um eigenständig agierende virtuelle Charaktere zu erschaffen. Werden diese autonomen Stimm-Klone vom Keyboard aus freigesetzt, offenbaren sie sich als eher unbeholfene soziale Akteure. In asynchronen Dialogen mischen sie sich jedoch in die klangliche Textur von Lucy und Feronias Performance ein.
DAPHNE VON SCHRADER (AT)

Die österreichische Musikerin und bildende Künstlerin Daphne von Schrader entfaltet ihre Praxis an der Schnittstelle von Klang, Ökologie und urbanem Leben. Orts- und lebensspezifisch arbeitet sie über verschiedene Medien hinweg und entwickelt mehrkanalige Kompositionen sowie konzeptuelle Lecture-Performances, die unsere großstädtischen, post-kapitalistischen Lebensgrundlagen hinterfragen. Sie dringt zu den Grundlagen dieses Daseins vor und sucht aktivistisch, Interferenzen durch die physiologischen und biologischen Effekte von Klangfrequenzen darzustellen. Dabei spielen wissenschaftliche und quantenmechanische Dimensionen, die dem Erleben hörender Organismen – ob menschlich oder mikrobiell – zugrunde liegen, eine Rolle.
Daphne montiert akustische Klangbilder, die medizinische Berichte als medical (her)storys vermitteln und eine dezidiert kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart formulieren. Ihre Erzählungen umfassen Phänomene, die von entzündeten Organen und mikroorganismischen Allianzen über die Auswirkungen von Lärmbelastung bis hin zur Hoffnung auf den Erhalt biodiverser Ökosysteme reichen. Fluid bewegt sie sich zwischen Makro- und Mikroperspektiven, von der Vogelperspektive bis zum intimen Horchen, und verwebt dabei Geräuschpartikel, Klangquanten, Liebeslieder und nicht wahrnehmbare Frequenzen zu sich ständig wandelnden, vielschichtigen Umgebungen. Selbst beschreibt sie ihren Ansatz, „Musik wie ein Delfin zu machen“. Damit bringt Daphne einen spielerischen, experimentellen und bisweilen auch humorvollen Geist in die Nachbarschaft des 8. Bezirks.
Daphne ist Gründungsmitglied des interdisziplinären Kollektivs Klub Montage, außerdem aktives Mitglied des Wiener Sandkasten Syndikats und langjährige Kollaborateurin des künstlerischen Netzwerks um die Semmelweisklinik.
Gefördert durch die MA 7 Kultur der Stadt Wien und die Bezirkskultur Josefstadt.